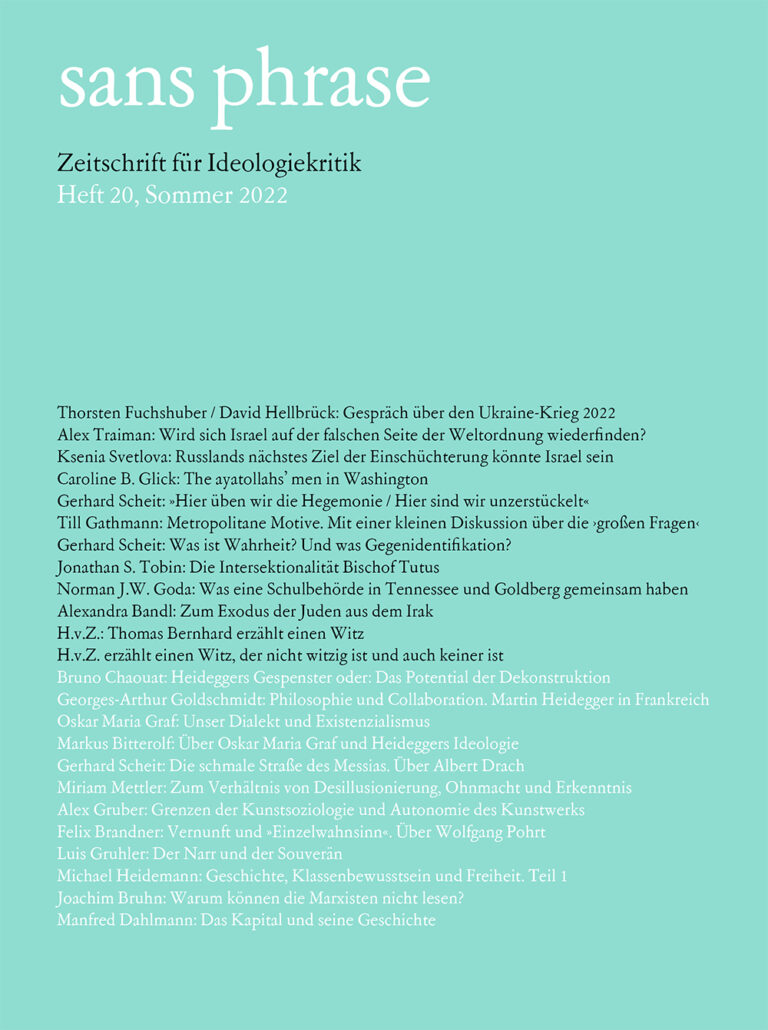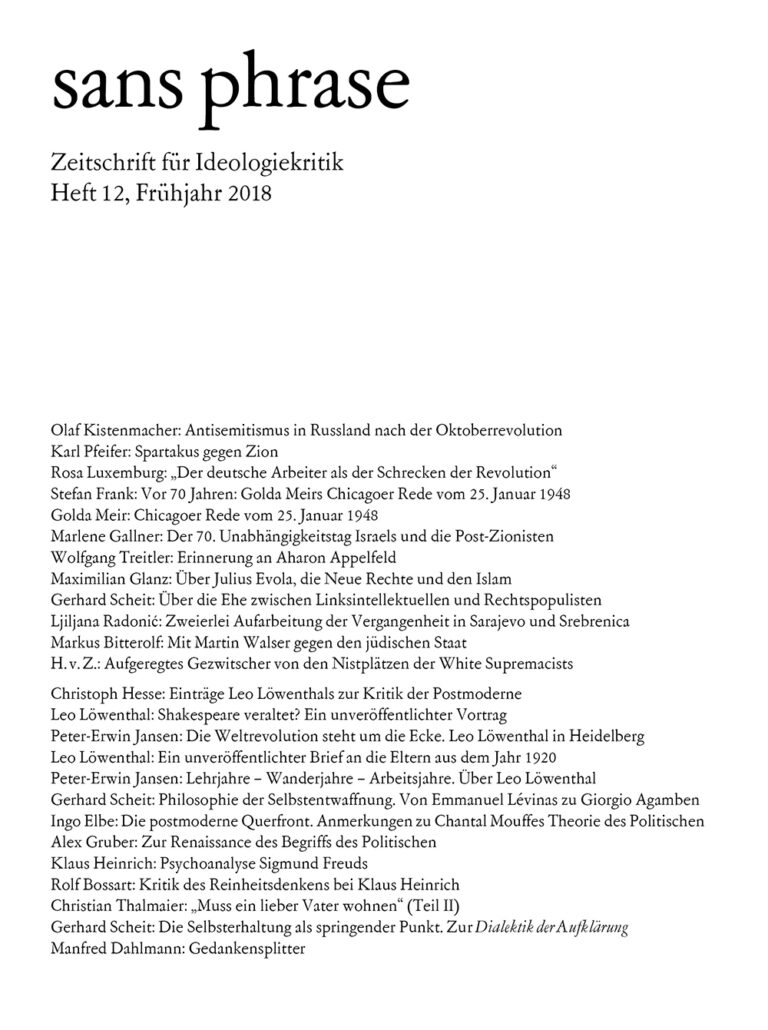Wenn der alternde Schriftsteller auf sein kindliches Selbst zurückblickt, so weiß er, was aus dem Menetekel an den Wänden von Marseille geworden ist: Der »alte Tötungswunsch« hat sich im Unmaß verwirklicht. Und so macht Cohen sich keine Illusionen, sein Schreiben könnte dem etwas anhaben.
Wozu dann dieses Buch? Es ist das Testament des alternden Schriftstellers: Totenklage, Anklage und Appell zugleich. Mit ihm tritt Cohen den Beweis an, dass die Ohnmacht der Sprache nicht das letzte Wort hat. Indem sein Schreiben unterschiedliche sprachliche Register zieht: erzählt, reflektiert, ironisiert, appelliert, anklagt, vor allem aber durch all das hindurch erinnert, erweist es seine »schwache messianische Kraft«. In oft biblisch anmutendem Ton besingt Cohen die Toten, ohne aber ein »kindisches Jenseits« anzurufen. Im Himmel wohnt kein guter Vater, dort kreist nur ein uns allen geduldig harrender Geier. Zu Brüdern machen uns keine hehren Werte, sondern allein der uns allen gleichermaßen drohende Tod. Doch bleibt diese Klage nicht bei solcher abstrakten Universalität stehen, die stets Gefahr läuft, die besonderen Opfer der Geschichte zu verdecken. Am Ende macht Cohen überdeutlich, dass seine Trauer den in Auschwitz Ermordeten gilt, darunter Angehörigen von ihm: den jüdischen Opfern der Vernichtung, die es »ohne den Straßenhändler und seine bösartigen Gleichgesinnten, seine unzähligen Gleichgesinnten in Deutschland und anderswo«, ohne all die »Judenhasser« nicht gegeben hätte.